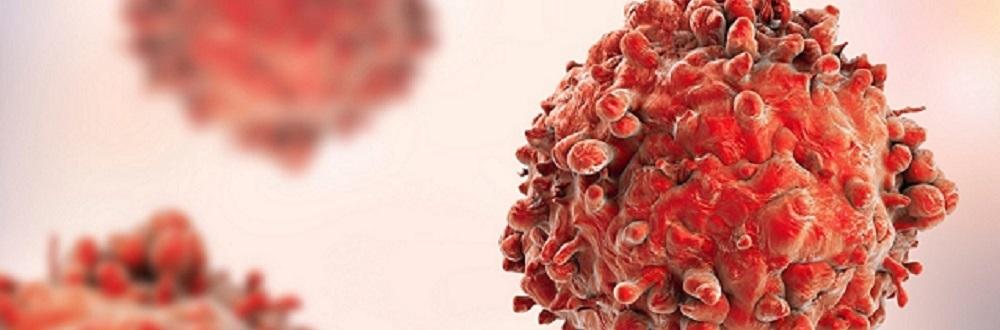Gezielte Therapien bei Krebserkrankungen
Wir forschen nach Lösungen, die Hoffnung geben.
Jedes Jahr erhalten rund 500.000 Menschen in Deutschland eine Krebsdiagnose.1 Die Zahl der Neuerkrankungen wird nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts in den kommenden Jahren weiter steigen.2
Sehr häufige Krebsarten sind Brustkrebs (Mammakarzinom) bei Frauen, Prostatakrebs (Prostatakarzinom) bei Männern, Lungenkrebs (Bronchialkarzinom) und Darmkrebs.3 Dazu kommen weniger häufige Krebserkrankungen, wie z.B. die Akute Myeloische Leukämie (AML), Magenkrebs oder Blasenkrebs.
Mehr zum Thema Onkologie in unserem Podcast
Sind Männer Vorsorgemuffel bei der Prostatakrebsvorsorge?
Im Gespräch mit Dr. Christoph Pies, Urologe sowie Buchautor, und Florian Nilles, Außendienst Key Account Manager bei Astellas, dreht sich in dieser Folge alles rund um den Movember. Zusammen mit einem renommierten Marktforschungsinstitut haben wir eine repräsentative Umfrage zum Thema Prostatakrebsvorsorge gestartet. Gemeinsam mit unserem Gast sprechen wir nun über einige überraschende Ergebnisse. Wir wollten von Herrn Pies wissen: sind Männer Vorsorgemuffel? Das konnte er, genau wie die Ergebnisse der Umfrage, bestätigen und erzählt von seiner persönlichen Erfahrung über die Jahre als Urologe. „Der Körper muss funktionieren, man kümmert sich nicht darum, wenn was kaputtgeht, wird man es schon irgendwie merken“. Diese tradierte Männerrolle überwog lange, befindet sich seit einigen Jahren aber im Wandel, wie Dr. Pies uns verrät: „Es wächst eine Generation nach, die gesundheitsbewusster ist“. Dass viele Männer sich aber immer noch sträuben, wenn es um Prostatakrebsvorsorge geht, überrascht den Urologen dennoch nicht: „Ich hatte die Zahl fast noch höher erwartet. Und ich kann das natürlich auch so ein bisschen verstehen“, gesteht er uns. Weitere Informationen zum Thema Prostatakrebsvorsorge und die wichtigsten Ergebnisse unserer Umfrage zum Nachlesen finden Sie hier:
astellas.com/de/presse/themen-hintergruende/prostatakrebs
Wie ein Sportangebot für Krebspatient:innen entsteht
Im Gespräch mit Dr. Joachim Wiskemann, Sportwissenschaftler und Gründer des Netzwerks OnkoAktiv, und Moderatorin Inga Höltmann geht es um die Beratung und Vermittlung von Bewegungsangeboten an Krebspatient:innen vor, während und nach ihrer Therapie. In unserer Folge mit dem Physiologen und Sportmediziner Prof. Dr. Klaus Baum konnten wir bereits feststellen, wie wichtig und hilfreich Bewegung und Sport für die Genesung von Krebspatient:innen ist. Doch wie gelangen sie an ein für sie geeignetes Sportangebot und was gibt es bei der Bewegungstherapie zu beachten? Dr. Wiskemann ist überzeugt: „Bewegungstherapie gehört wirklich wie eine medikamentöse Therapie zur onkologischen Behandlung dazu. Daher gibt es das Netzwerk OnkoAktiv“. Sport und Bewegung während einer Krebstherapie hat bei Patient:innen einen ganz unterschiedlichen Stellenwert. Während für die einen sportliche Betätigung trotz Krebstherapie und entsprechenden Begleitsymptomen unproblematisch ist, fühlen sich andere körperlich nicht in der Lage, Bewegung in ihre Therapie mit einzubauen. Dem möchten Dr. Wiskemann und sein Netzwerk entgegenwirken: „Situationen, in denen man keinen Sport machen darf, aus medizinischen Gründen, die gibt es eigentlich so gut wie gar nicht“. Wichtig ist es Patient:innen, aber auch Ärzt:innen und Trainer:innen entsprechend zu beraten und zu schulen: „Patient:innen ist hochgradig wichtig, dass der Therapeut oder die Therapeutin versteht, in welcher Situation sie sich überhaupt befinden. Also was bedeutet es, wenn man eine Chemotherapie bekommt? Was macht die grundsätzlich noch für Nebenwirkungen? Was heißt überhaupt Krebs? Dafür setzen wir uns ein“. Weitere Informationen zum Netzwerk OnkoAktiv und die Arbeit von Joachim Wiskemann finden Sie hier: netzwerk-onkoaktiv.de/
Wie Komplementärmedizin die Krebstherapie unterstützen kann
Im Gespräch mit Dr. Axel Eustachi, Facharzt für Allgemeinmedizin in München und Experte für Komplementärmedizin, und Moderatorin Inga Höltmann geht es darum, welchen positiven Effekt die Komplementärmedizin auf die Lebensqualität von Krebspatient:innen haben kann. Die Komplementärmedizin versteht sich als Zusatz zu schulmedizinischen Maßnahmen. Was können Krebspatient:innen Ergänzendes tun, um ihre Behandlung zu unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es, um die Nebenwirkungen der Strahlen- oder Chemotherapie zu lindern? Was kann Komplementärmedizin leisten? „Komplementärmedizinische Maßnahmen können bestimmte Aspekte, die etwas mit Lebensqualität zu tun haben – beispielsweise Stressempfinden aufgrund der Diagnose oder Nebenwirkungen der Behandlung – angehen und zum Teil für die Patientinnen und Patienten wirklich erheblich verbessern“, sagt Dr. Axel Eustachi. Letztlich gehe es darum, im Einzelfall zu klären, welche Beschwerde durch die konventionellen Maßnahmen nicht adäquat behandelt werden könne und wo es Sinn ergibt komplementärmedizinische Maßnahmen zu ergänzen. Für die Zukunft wünscht sich Dr. Eustachi für Patient:innen einen einfacheren Zugang zur Komplementärmedizin. Dafür ist auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Schul- und Komplementärmedizin entscheidend beispielsweise durch die Integration bestimmter komplementärmedizinischer Aspekte in die Ausbildung der Mediziner:innen. Wenn beide Seiten transparenter zusammenarbeiten, eröffnen sich für Krebspatient:innen mehr Möglichkeiten zu einer ganzheitlichen Behandlung.
Wie Onkolots:innen durch Krebstherapien begleiten
Im Gespräch mit Dr. Ralf Porzig, Geschäftsführer der Sächsischen Krebsgesellschaft e.V., und Ulrike Filippig, einer selbständigen Onkolotsin, spricht Inga Höltmann über das Projekt Onkolotsen und die wichtige Rolle, die Onkolots:innen als Ratgeber:innen für Krebspatient:innen und vor allem Angehörige übernehmen. Eine Krebsdiagnose kann Betroffene aus ihrem Alltag reißen und konfrontiert sie und ihre Familien mit Ängsten, Unsicherheiten und organisatorischen Herausforderungen. Neben behandelnden Ärzt:innen sind Onkolots:innen hierfür die ideale Anlaufstelle. Ob die Begleitung zu Arztterminen, Beratung zu verschiedenen Versorgungsangeboten oder Unterstützung bei der Lösung privater Probleme – Onkolots:innen stehen Betroffenen auf ihrem Weg durch die Krankheit zur Seite. „Bei einer Krebsdiagnose gibt es viele Krisen zu bewältigen. Da brauchen wir Menschen einfach die Unterstützung von anderen Menschen”, erklärt Ulrike Filippig. Das Projekt Onkolotsen der Sächsischen Krebsgesellschaft soll in der Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Noch mehr Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, sich zu Onkolots:innen auszubilden, um Krebspatient:innen unterstützen zu können. „Unsere Mission für dieses Projekt ist, dass wir Onkolots:innen für alle Betroffenen und ihre Angehörigen verfügbar machen können – das bedeutet natürlich auch die Finanzierung dieser Leistung. Vor diesem Hintergrund ist unser großes Ziel, die Onkolots:innen in die Regelversorgung zu überführen”, sagt Dr. Ralf Porzig.
Wie eine individuelle Schmerztherapie Krebspatienten helfen kann
Im Gespräch mit Dr. Uwe Kern, Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesie sowie Schmerztherapeut und Moderatorin Inga Höltmann, geht es um Schmerzen und Schmerztherapie – ganz allgemein, aber vor allem in Verbindung mit (Prostata-)Krebserkrankungen. Weil Schmerz nicht gleich Schmerz ist, bedarf es auch einer individuellen Schmerztherapie, um die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern. Eine wichtige Rolle spielt die Zusammenarbeit zwischen allen behandelnden Ärzten von Onkologen über Psychologen bis hin zu Schmerztherapeuten. „Das ist das Wichtige, dass wir untereinander kommunizieren und uns ein Netzwerk schaffen, wo wir wissen: Jetzt bräuchte unser Patient dies oder das", sagt Dr. Uwe Kern. Ein noch besserer interdisziplinärer Austausch und strukturelle Veränderungen werden in Zukunft ein wichtiges Element einer erfolgreichen Schmerztherapie sein, damit bspw. Krebspatienten von neuen Erkenntnissen aus der Forschung und weiterer Spezialisierung in der Schmerztherapie profitieren. „In dem Moment, wo man in der Medizin zufrieden ist, hat man aufgehört, besser werden zu wollen. Das ist nicht gut“, sagt Dr. Kern.
Wie Man(n) mit Sport eine Krebstherapie unterstützen kann
Im Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Baum, Physiologe und Sportwissenschaftler, spricht Moderatorin Inga Höltmann darüber, wie wichtig es ist Bewegung und Sport in die Therapie von Krebs- und im Speziellen Prostatakrebspatienten einzubinden – und das von Behandlungsbeginn an. Denn eine ganzheitliche Therapie hört nicht beim Medikament auf. Prof. Dr. Baum gibt spannende Einblicke darin, wie sich sportliche Aktivität sowohl auf das physiologische als auch das psychologische Wohlbefinden und das Lebensgefühl von Patienten positiv auswirken kann. Gerade bei Prostatakrebs hilft regelmäßiges Training dabei, die Nebenwirkungen der medikamentösen Behandlung wie Muskelschwund und Ermüdungssyndrom zu minimieren. Je höher die körperliche Fitness und allgemeine Leistungsfähigkeit, umso besser können Patienten die Therapien und mögliche Folgen vertragen. Neben dem Bewusstsein für die Vorteile von Bewegung und Sport spielt vor allem Motivation und die Unterstützung von Angehörigen sowie behandelnde Ärzt:innen eine wichtige Rolle. „Die Unterstützung aus dem familiären Umfeld, macht es den Patienten wesentlich leichter, im psychischen, aber auch im körperlichen Sinne indem unter Umständen der Partner, die Partnerin selber am Sportangebot teilnimmt und damit die Freuden der Bewegung teilt“, betont Prof. Dr. Baum.
Wie Männer mit der Diagnose Prostatakrebs umgehen
Im Gespräch mit Dr. Christian Lüdke, Psychotherapeut und Trauma-Experte und Moderatorin Inga Höltmann geht es um die Rolle der Psyche im Umgang mit einer Krebsdiagnose und deren Behandlung. Beides sind tiefe Einschnitte in das Leben von Patient:innen und stellen deren bisheriges Leben auf den Kopf. Im Fokus steht die Frage, welche Unterschiede es im Umgang mit Krebs zwischen Frauen und Männern gibt, wie das Leben und das soziale Umfeld von Patient:innen beeinflusst wird und wie psychologische Online-Beratungsangebote Patient:innen im Umgang mit ihrer Erkrankung unterstützen können. In Europa zählt bspw. Prostatakrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern. Die Diagnose ist häufig vor allem eine emotionale Herausforderung, mit der Männer erst lernen müssen, umzugehen und überhaupt darüber sprechen zu können. „Für den Umgang und die Behandlung einer Krebserkrankung ist die Psyche ganz wichtig. An der Diagnose können wir zunächst einmal nichts ändern, aber wir können bestimmen, wie wir darüber denken“, bestätigt Dr. Christian Lüdke. Für ihn sind digitale Angebote in Form einer Online-Therapie ein wichtiges Instrument der Zukunft, um Patient:innen kompetent beraten und unterstützen zu können und so eine ganzheitliche Behandlung zu ermöglichen.
Schwerpunkte von Astellas in der Onkologie
In den letzten zehn Jahren haben wir in der Onkologie verschiedene Therapien für solide und hämatologische Tumore entwickelt. Zu unserem onkologischen Portfolio gehören Medikamente zur Behandlung im frühen Stadium ebenso wie für fortgeschrittene Phasen einer Krebserkrankung. Der Ansatz der Therapien ist, ein möglichst langes progressionsfreies Überleben zu ermöglichen, das bedeutet: die Lebensspanne nach Beginn einer Behandlung (auch im Rahmen klinischer Studien) bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Krankheit fortschreitet. Damit möchten wir Patient:innen ein Stück Lebenszeit und -qualität erhalten bzw. zurückgeben.
Bei Astellas arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Kompetenz in der Krebsforschung und unser Angebot an Krebstherapeutika auszubauen. Wir konzentrieren uns auf die Erforschung von Wirkstoffen, die bei vielen – auch seltenen – Krebserkrankungen Hoffnung geben. Derzeit befinden sich 11 Wirkstoffe zur Behandlung verschiedener Krebsarten – wie z.B. Prostatakarzinome, Leukämie oder Nierenzellenkarzinome in unterschiedlichen Entwicklungsphasen – von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Entwicklungsphase und Zulassungsbeantragung.
Wir sind überzeugt, dass Partnerschaften der Schlüssel zu innovativen Therapien sind. Darum arbeiten wir in der Entwicklung mit anderen Pharmaunternehmen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zusammen. Denn nur durch die Bündelung des Expertenwissens aus Industrie und Forschung können wir einen echten Mehrwert für Patient:innen generieren.
Forschung und Förderung
Wir beschränken uns jedoch nicht nur auf die eigene Forschung und Entwicklung, sondern unterstützen auch andere herausragende Wissenschaftler und Projekte: Astellas hat unter anderem den „Forschungspreis Prostatakarzinom“ gestiftet, der seit 2011 von der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) vergeben wird und mit 10.000 Euro dotiert ist. Denn: Trotz der guten Behandlungsmöglichkeiten sind auch bei Prostatakrebs noch viele Fragen unbeantwortet.
Wir unterstützen die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) bei ihrer Kampagne „Urologie für alle“, die unter anderem auf die Früherkennungsuntersuchungen für Männer aufmerksam macht. Astellas richtet interdisziplinäre Foren aus, um den Austausch über wichtige Fragen der onkologischen Forschung zu fördern.
Mehr Informationen zur Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen und Forschungsinstituten finden Sie hier.
In unserem Presseportal finden sie weitere Themen & Hintergründe zu Prostatakrebs und AML.
Referenzen:
1 Robert Koch Institut - Zentrum für Krebsregisterdaten: Krebsdiagnosen im Lebensverlauf: www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Kurzbeitraege/Archiv2018/2018_4_Thema_des_Monats_lebensverlauf.html. Letzter Zugriff Mai 2022.
2 Robert Koch Institut - Zentrum für Krebsregisterdaten: Neue Zahlen zu Krebs in Deutschland: www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2019/16_2019.html. Letzter Zugriff Mai 2022.
3 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Veränderung der Todesursachenstruktur in Deutschland 1980 bis 2018: https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/S20-Todesursachen-ab-1980.html. Letzter Zugriff Mai 2022.